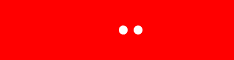(24.01.2012)
![]() Die meisten schweizerischen Bahnstrecken dienen neben dem Güterverkehr auch dem Transport von Reisenden. Während einige rein touristische Bahnen kaum Güter befördern, existierten anderseits früher auch Bahnen, die sich ausschliesslich dem Gütertransport widmeten und nur in Ausnahmefällen Personen beförderten. Erstaunlicherweise konnten zwei solche reine Güterbahnen jahrelang vor den Toren der Bundesstadt den Betrieb aufrechterhalten; technische und wirtschaftliche Gründe führten aber dazu, dass beide Bahnen heute von der Bildfläche verschwunden sind.
Die meisten schweizerischen Bahnstrecken dienen neben dem Güterverkehr auch dem Transport von Reisenden. Während einige rein touristische Bahnen kaum Güter befördern, existierten anderseits früher auch Bahnen, die sich ausschliesslich dem Gütertransport widmeten und nur in Ausnahmefällen Personen beförderten. Erstaunlicherweise konnten zwei solche reine Güterbahnen jahrelang vor den Toren der Bundesstadt den Betrieb aufrechterhalten; technische und wirtschaftliche Gründe führten aber dazu, dass beide Bahnen heute von der Bildfläche verschwunden sind.
Die Steinbruchbahn Ostermundigen - die älteste Zahnradbahn Europas
Nach landläufigem Brauch wird die Vitznau–Rigi-Bahn als älteste Zahnradbahn der Schweiz bezeichnet; sie wurde am 21. Mai 1871 feierlich eröffnet und zwei Tage später in Betrieb genommen. Nach den Chronisten erfolgte erst viereinhalb Monate später, nämlich am 6. Oktober 1871, die Eröffnung der Steinbruchbahn Ostermundigen. Soweit sind die Fakten klar. Warum aber die kleine unscheinbare bernische Güterbahn dennoch die älteste Zahnradbahn von Europa ist, lässt sich aus den zeitgenössischen Quellen einwandfrei herleiten.
Bereits anno 1864 reichte die Steinbruchgesellschaft Ostermundigen ein Gesuch um eine Konzession zum Bau einer Anschlussbahn von der damaligen Station Ostermundigen der Schweizerischen Centralbahn (SCB) – diese befand sich dort, wo heute noch bei der Bushaltestelle und beim Restaurant «Waldeck» eine Barriere und verlassene Geleise an die frühere Streckenführung erinnern – zu den Steinbrüchen am Ostermundigenberg ein. Grosse Unterstützung erhielt das Projekt durch den damaligen Präsidenten der Eidgenössischen Bank und früheren Bundesrat Jakob Stämpfli.
Die Bahneinweihung muss warten
Niklaus Riggenbach, ein Freund von Stämpfli, schlug dabei vor, die grosse Steigung mit Hilfe einer Zahnstange zu bewältigen, wie sie in Amerika erstmals 1869 von Sylvester Marsh bei der Bahn auf den Mount Washington angewendet wurde. Riggenbach erhielt tatsächlich den Auftrag zum Bahnbau, und bereits 1870 war die 1,45 Kilometer lange Bahn gebaut. Ein bis 10 Prozent steiler Abschnitt von 560 Metern Länge war mit Zahnstangen nach System Marsh ausgerüstet. Aber die Bahneinweihung musste aus einleuchtenden Gründen verschoben werden. Warum das? Weil Riggenbach gleichzeitig auch die Vitznau–Rigi-Bahn baute und diese als wichtigere Bahn betrachtet wurde, musste die offizielle Inbetriebnahme noch etwas hinausgeschoben werden. Gefahren wurde aber trotzdem. Riggenbach konnte so das Zahnstangensystem erproben und gleichzeitig einige Verbesserungen anbringen, was zum so genannten System Riggenbach führte. Nachdem am 21. Mai 1871 (just an einem Geburtstag von Niklaus Riggenbach) die Einweihungsfeierlichkeiten der Rigibahn über die Bühne gegangen waren und auch schon reichlich Wasser die Aare herabgeflossen war, wurde endlich am 12. September des gleichen Jahres die Steinbruchbahn Ostermundigen offiziell dem Betrieb übergeben. Die Einweihung, an der gar fünf der sieben Bundesräte teilgenommen haben sollen, fand sogar erst drei Wochen später statt, nämlich am 6. Oktober 1871.
Die Dampflok «Gnom» erhält Verstärkung
Während den ersten sechs Betriebsjahren wurde die Dampflok «Gnom» eingesetzt und anno 1876 die zweite Lok «Elfe» in Betrieb genommen. Der graugrünliche Berner Sandstein wurde dank Bahnanschluss in der ganzen Schweiz konkurrenzfähig. Viele Bauten, wie das Bundesgericht in Lausanne und das Hotel National in Luzern zeugen heute noch davon. Im Jahr 1902 wurde der Bahnbetrieb wegen Unrentabilität eingestellt, und das nach 31 Betriebsjahren. Erfreulicherweise sind beide Dampflokomotiven der Nachwelt erhalten geblieben. Die «Elfe» steht zusammen mit einem mit Sandsteinen beladenen Güterwagen seit 1981 bei der Bushaltestelle «Zollgasse» in Ostermundigen.
Das war die Gaswerkbahn
Über 60 Jahre lang, nämlich von 1906 bis 1967, diente die Gaswerkbahn dem Kohlentransport von der Station Wabern der Gürbetalbahn zum Gaswerk in der Berner Lindenau. Längst sind die Geleise weggeräumt, aber auch nach über 40 Jahren lässt sich der Verlauf dieser Bahn sowohl auf Plänen wie auch im Gelände sehr gut nachvollziehen. Glücklicherweise ist auch die über 50 Jahre lang eingesetzte Dampflokomotive der Nachwelt erhalten geblieben.
Das erste Gaswerk der Schweiz im Marzili in Bern
Bereits in den Jahren 1841 bis 1843 erstellte die private Gasbeleuchtungs-Gesellschaft mit dem malerischen Namen «Société Bernoise dite Compagnie du Soleil» im Marzili das erste Gaswerk der Schweiz an der Weihergasse 3. Verarbeitet wurde dort zunächst einheimische Kohle vom Beatenberg und aus Boltigen, die mit Schiffen auf Thunersee und Aare zugeführt wurde. Später wurde dank dem Bau von Eisenbahnlinien ausländische Kohle bevorzugt. Diese stammte aus dem Saargebiet und später aus dem Ruhrgebiet und aus Belgien. Der Betrieb wurde 1876 in den Neubau in der Lindenau an der Sandrainstrasse verlegt. Die für das Gaswerk bestimmte Kohle (der Jahresbedarf betrug rund 20'000 Tonnen) musste mit Pferdefuhrwerken vom Bahnhof Bern ins Gaswerk zugeführt werden. Erst die Eröffnung der Gürbetalbahn im Jahr 1901 liess die Idee aufkommen, von der Bahnstation Wabern aus ein Anschlussgleis zu bauen.
Die Gürbetalbahn ist vom Kohlentransport wenig erbaut
Der rund 2,5 Kilometer lange Schienenweg wurde im Herbst 1906 in Betrieb genommen. Eine ursprünglich geplante Linienführung mit einer Zahnstangenstrecke wurde zugunsten einer reinen Adhäsionsstrecke fallengelassen; diese wies dann immer noch eine Steigung von 35 Promillen auf. Im Gaswerk sorgten dann Drehscheiben für die Verbindungen mit den Stumpengeleisen zu Kohlehalden und Fabrikationsgebäuden. Zunächst sorgte die damals noch selbständige Gürbetalbahn (GTB) mit eigenen Lokomotiven für die Zufuhr der Kohlenwagen. Wie der damalige Direktor der Bern–Lötschberg–Simplon-Bahn (BLS), Professor Fritz Volmar, in seinem 1941 erschienenen Werk über die Gürbetalbahn schreibt, war die Bahn keineswegs erbaut über die täglich 15 bis 20 zu transportierenden Kohlenwagen, da diese lediglich vom Güterbahnhof Bern Weyermannshaus nach Wabern zu befördern waren. Zudem war der Rücktransport der leeren Wagen wenig einträglich. Verbesserung brachte dann das Jahr 1939, als englische Kohle vom Mittelmeerhafen Genua bezogen wurde und die Kohlenwagen von Thun durchs Gürbetal nach Wabern rollten.
Das Gaswerk beschafft eine eigene Dampflokomotive
Am 1. Mai 1908 erhielt dann das Gaswerk eine eigene Lokomotive. Die Nassdampf-Lokomotive mit der offiziellen Bezeichnung E 3/3 Nr. 1 wurde von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur (SLM) unter der Fabrikationsnummer 1901 erbaut. Sie vermag eine Anhängelast von 400 Tonnen zu ziehen.
Zu ihrem Namen «Lise» soll die Dampflok am 2. Juni 1953 gekommen sein. Damals wurde ein langjähriger Lokführer verabschiedet, wobei die Übergabe an den neuen Dampfmeister Ernst Haefeli just an jenem Tage stattfand, als die noch heute amtierende Königin Elizabeth II. von Grossbritannien und Nordirland gekrönt wurde. Neben Gütern beförderte die Dampflok ausnahmsweise auch Personen, so im Dezember 1967, als die Bundesstadt offiziell an den Gasverbund Mittelland angeschlossen wurde und die geladenen Gäste zu einer Fahrt an das Aareufer kamen.
Das Ende der Gaswerkbahn kündigt sich an
Mit dem Anschluss Berns an das überregionale Ferngasnetz schlug die Abschiedsstunde für die Gaswerkbahn. Der früher mit Schiffen, dann mit Fuhrwerken und schliesslich während über 60 Jahren per Bahn zugeführte Rohstoff wurde nicht mehr benötigt, da nun die Ferngasleitung das benötigte Gas in konsumfertiger Art zuführte. Die Fabrikation von Leucht- und Brennstoff mittels Steinkohleentgasung hatte endgültig ausgespielt und einer neuen Technik Platz zu machen. Zunächst bezog Bern entgiftetes Stadtgas aus Basel und ab 1972 Erdgas.
Am 23. April 1971 war dann der Tag der feierlichen Aufnahme des Dampfbetriebs im Sensetal. 1993 schenkte die Stadt Bern die «Lise», die bis anhin nur als Leihgabe zur Verfügung gestan-den hatte, dem Verein Dampf-Bahn Bern. Heute ist die Lok im Depot Konolfingen remisiert.
Die Gaswerkbahn hinterlässt ihre Spuren
Trotzdem nach der Betriebseinstellung bald die Schienen entfernt und das ehemalige Bahnareal an Private verkauft werden konnte, ist der Streckenverlauf noch heute sehr gut nachvollziehbar. Der untere Teil des Trassees dient heute als bequemer Spazier- und Veloweg. Verschwunden ist hingegen jene Brücke, die zwischen den Häusern 32 und 34 die Eichholzstrasse überspannte. Der Pappelweg lässt gut noch den ehemaligen Verlauf der Gaswerkbahn erkennen. Auf der Höhe der Seftigenstrasse 300 überquerte die Gaswerkbahn die Strasse, gut gesichert durch ein Andreaskreuz samt Blinklicht.