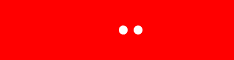(10.02.2016)
Rund 40.000 Züge im Personennah-, -fern- und Güterverkehr sind tagtäglich auf dem deutschen Schienennetz unterwegs, bringen Millionen Reisende von A nach B oder Güter zur rechten Zeit zu ihrem Bestimmungsort. Gesteuert wird der Zugverkehr durch bundesweit rund 3.000 Stellwerke.
Mechanische Stellwerke
Bei dieser Bauart werden Signale und Weichen über Hebel und Drahtzüge per Hand gestellt. Weichen können damit nur bis zu 800 und Signale bis maximal 1.800 Meter Entfernung gestellt werden. Die Stellbezirke, also die Streckenabschnitte, für die der Fahrdienstleiter in seinem Stellwerk verantwortlich ist, sind daher vergleichsweise klein. Hinzu kommt, dass sich der Stellwerksmitarbeiter per Augenschein davon überzeugen muss, ob das Gleis, in das ein Zug fahren soll, auch wirklich frei ist. Größere Bahnhöfe erfordern deshalb stets mehrere dieser Stellwerke.
Elektromechanische Stellwerke
Diese Bauform wandelt mechanische Bedienhandlungen des Personals in elektrische Impulse um. Weichen und Signale stellen sich elektrisch um. Die Betriebszustände der Signale und Weichen werden im Stellwerk über verschiedenfarbige Lichtpunkte angezeigt. Der Fahrdienstleiter überzeugt sich per Augenschein davon, dass die Gleise für Zug- oder Rangierfahrten frei sind.
Relaisstellwerke
Die Gleispläne der Bahnhöfe und der angrenzenden Streckenabschnitte sind bei diesem elektrischen Stellwerk schematisch auf Stelltischen abgebildet. Hier werden alle Bedienhandlungen vorgenommen und Betriebszustände angezeigt. Die Gleise werden überwiegend automatisch frei gemeldet.
Elektronische Stellwerke (ESTW)
Bei dieser Bauart werden die Signale und Weichen mit Computertechnik per Mausklick gestellt. Fahrdienstleiter können in den ESTW größere regionale Bereiche steuern und überwachen. Viele Fahrdienstleiter arbeiten inzwischen in bundesweit sieben Betriebszentralen, wodurch ein hoher Automatisierungsgrad in der Betriebsführung erreicht wird.